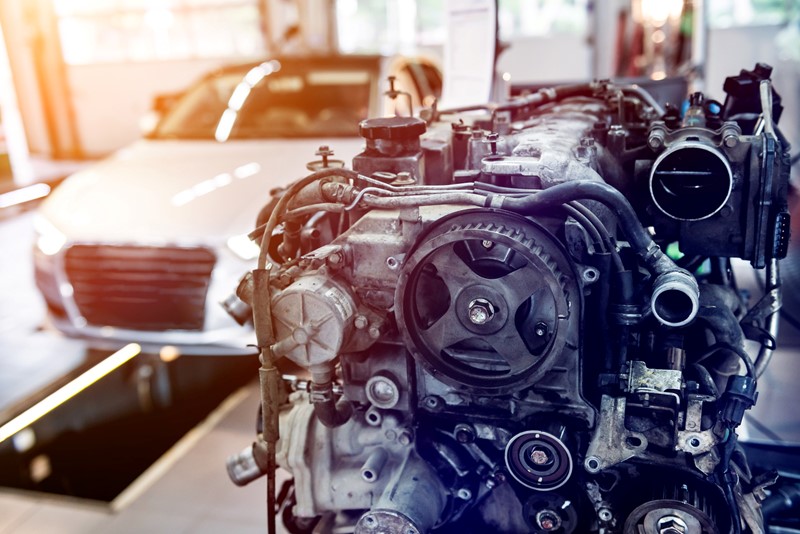Der Bundesrat hat dem Steueränderungsgesetz am 19.12.2025 zugestimmt, sodass u.a. die Anhebung der Entfernungspauschale ab dem 1.1.2026 anzuwenden ist. Es werden auch Maßnahmen umgesetzt, die nur technischen Charakter haben. Die nachfolgenden Ausführungen geben einen Überblick über die wichtigsten Änderungen bei der Einkommensteuer.
Änderungen bei der Einkommensteuer:
1. Entfernungspauschale, § 9 EStG
Die Entfernungspauschale wird ab dem 1.1.2026 für alle Steuerpflichtigen auf 0,38 € ab dem 1. Entfernungskilometer angehoben. Das gilt auch für Steuerpflichtige im Rahmen einer beruflich veranlassten doppelten Haushaltsführung.
2. Übungsleiter- und Ehrenamtspauschale, § 3 Nr. 26, 26a EStG
Die Übungsleiterpauschale von derzeit 3.000 € wird ab 2026 auf 3.300 € und die Ehrenamtspauschale von 840 € auf 960 € angehoben.
Außerdem wird klargestellt, dass die Voraussetzung der Förderung gemeinnütziger, mildtätiger oder kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 AO) sowohl für juristische Personen des öffentlichen Rechts als auch für Körperschaften gelten, die unter § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG fallen (gilt nach der Verkündung in allen offenen Fällen).
3. Steuerbefreiung von Prämien bei Olympischen und Paralympischen Spielen, § 3 Nr. 73 EStG
Prämienzahlungen der Stiftung der Deutsche Sporthilfen, die für Platzierungen bei Olympischen oder Paralympischen Spielen gewährt werden, sind ab 2026 von der Einkommensteuer befreit.
4.Doppelte Haushaltsführung im Ausland, § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 4 EStG
Als Unterkunftskosten für eine doppelte Haushaltsführung sind die tatsächlichen Aufwendungen für die Nutzung der Unterkunft anzusetzen. Für die Nutzung einer Wohnung im Ausland gilt ab 2026 ein Höchstbetrag von 2.000 € im Monat (= das doppelte des Inlandsbetrags). Der Höchstbetrag für die Wohnung im Ausland gilt nicht, wenn eine Dienst- oder Werkswohnung verpflichtend und zweckgebunden genutzt werden muss oder deren Kosten für Zwecke des Mietzuschusses nach § 54 des Bundesbesoldungsgesetzes als notwendig anerkannt worden sind.
5. Gewerkschaftsbeiträge als Werbungskosten (§ 9a Satz 3 EStG)
Beitragszahlungen an Gewerkschaften sind Beiträge zu Berufsständen und sonstigen Berufsverbänden, deren Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist. Diese können ab 2026 zusätzlich zum Arbeitnehmer-Pauschbetrag als Werbungskosten berücksichtigt werden, wenn und soweit die tatsächlichen Aufwendungen den Werbungskostenpauschbetrag von 1.230 € nicht überschreiten.
6. Parteispenden, §§ 10b Abs. 2 Satz 1, 34g Satz 2 EStG
Der Höchstbetrag für den Abzug von Spenden/Zuwendungen an politische Parteien wird ab 2026 von 1.650 € auf 3.300 € (bei Zusammenveranlagung 6.600 €) erhöht. Soweit ein Abzug bei den Sonderausgaben in Betracht kommt, wird der geltende Höchstbetrag von 825 € auf 1.650 € angehoben (bei Zusammenveranlagung auf 3.300 €).
7. Verlustabzug bei der Tarifermäßigung für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, § 32c Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG
§ 32c Ab. 5 EStG enthält Tatbestände, die die Tarifermäßigung ausschließen. Ein Ausschlussgrund ist dabei der Verlustrücktrag aus einem Veranlagungszeitraum (VZ) des zweiten Betrachtungszeitraums in einen VZ des ersten Betrachtungszeitraums. Die bisherige Fassung berücksichtigt nicht die Fallkonstellation, in der ein Verlust des ersten VZ des zweiten Betrachtungszeitraums in den vorletzten VZ des ersten Betrachtungszeitraums zurückgetragen wird. Dies wird nun angepasst. (Gilt ab VZ 2026)
8. Klarstellung zur Pauschalierungsmöglichkeit bei Betriebsveranstaltungen, § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG
Entgegen seiner bisherigen Rechtsprechung hat der BFH entschieden, dass eine Betriebsveranstaltung i. S. d. § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG auch dann vorliegt, wenn sie nicht allen Angehörigen eines Betriebs oder eines Betriebsteils offensteht. Der BFH begründet dies damit, dass das Tatbestandsmerkmal „Betriebsveranstaltung“ in § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG der Legaldefinition in § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a Satz 1 EStG entspreche. Begriffe, die in verschiedenen Vorschriften desselben Gesetzes verwendet werden, seien grundsätzlich einheitlich auszulegen.
Im Gesetz wird daher nun ausdrücklich klargestellt, dass die Pauschlierungsmöglichkeit für gezahlten Arbeitslohn aus Anlass von Betriebsveranstaltungen nur dann besteht, wenn die Teilnahme an der Betriebsveranstaltung allen Angehörigen des Betriebs oder eines Betriebsteils offensteht. (Gilt ab VZ 2026)
9. Zeitliche Befristung der Mobilitätsprämie aufgehoben (§ 101 Satz 1 EStG)
Die zeitliche Befristung der Mobilitätsprämie, die für Steuerpflichtige mit geringeren Einkünften gilt, ist auch nach 2026 weiterhin anzuwenden.
Quelle:Sonstige | Gesetzesänderung | Bundesratsdrucksache 745/25 | 18-12-2025