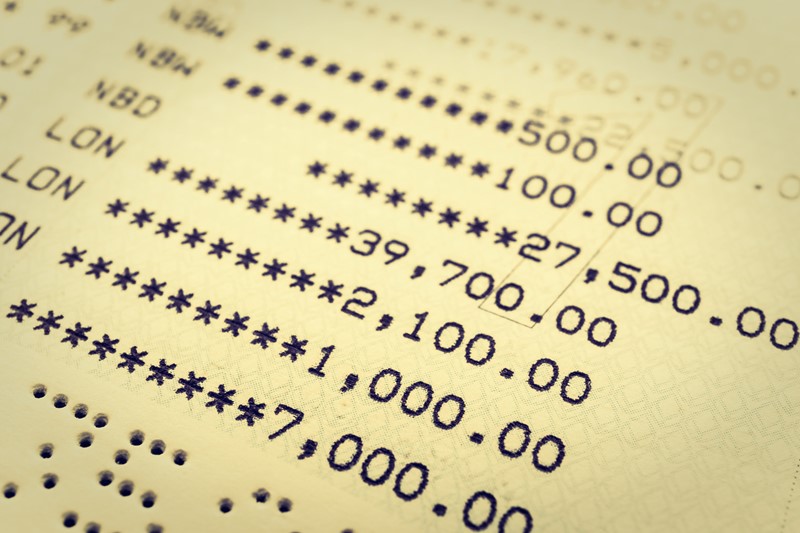Bei Darlehensverhältnissen zwischen nahestehenden Personen sind Besonderheiten zu beachten. Wird Kapitalvermögen auf die Kinder übertragen, führt das dazu, dass – wenn die Übertragung steuerlich anerkannt wird – die Einkünfte aus der Kapitalanlage dem Kind zuzurechnen sind.
Hat das Kind keine weiteren steuerpflichtigen Einnahmen, bleiben bei diesem im Veranlagungszeitraum 2025 Einnahmen i.H.v. 13.132 € (Grundfreibetrag 12.096 € + Sparer-Pauschbetrag 1.000 € + Sonderausgaben-Pauschbetrag 36 €) steuerfrei. Voraussetzung ist, dass die Eltern bei Einrichtung der Depotkonten zugunsten ihrer Kinder unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass sie ihren Kindern unwiderruflich Vermögen zuwenden wollen. Dieser Wille muss für die Bank deutlich erkennbar sein. In den Kontoeröffnungsblättern müssen die Kinder als Vertragspartner und Kontoinhaber genannt und besondere, anderslautende Gläubigerabreden dürfen nicht getroffen sein. Die Bestellung eines Ergänzungspflegers ist bei einer reinen Schenkung nicht erforderlich. Insoweit liegt kein schädliches In-Sich-Geschäft der Eltern als Schenker und Vertreter der Beschenkten (Kinder) vor. Denn die Regelung greift nicht ein, wenn das Rechtsgeschäft dem Minderjährigen lediglich Vorteile bringt. Hiervon ist bei einer Geldschenkung (oder Übertragung von Schuldverschreibungen u.Ä., Wertpapieren, die nur Gläubiger-, aber keine Gesellschaftsrechte einräumen) stets auszugehen.
Die Zurechnung des Kapitalvermögens und der Einkünfte setzt weiterhin voraus, dass die Eltern dieses – getrennt von ihrem eigenen Vermögen – fortan wie Kindesvermögen verwalten. Hieran fehlt es, wenn nach einigen Jahren ein Teil des Gelds zur gemeinsamen Lebensführung verwendet wird.
Wichtig ist auch, dass der Beschenkte mit seinem Vermögen Marktchancen ausnutzen kann. Das ist nicht der Fall, wenn ein Gesellschafter einem Angehörigen ein zinsloses Darlehen zur Verfügung stellt (Abbuchung auf dem Kapitalkonto), welches anschließend als Darlehen an die Gesellschaft fällig wird.
Zufluss der Einnahmen
Wann die Einnahme aus Kapitalvermögen zugeflossen ist, regelt § 11 EStG. Der Zufluss (i. d. R. durch tatsächliche Zahlung oder Verrechnung) ist dann anzunehmen, wenn der Empfänger die wirtschaftliche Verfügungsmacht über die Einnahme erhält. Erfolgt die Zahlung der Kapitaleinnahmen durch Gutschrift, sind diese zugeflossen, wenn sie (in den Büchern des Zahlungsverpflichteten) dem Konto des Empfängers gutgeschrieben werden. Trotz Gutschrift liegt kein Zufluss vor, wenn der Schuldner nicht liquide ist. Auch bei Gutschrift auf einem Sperrkonto liegt steuerlich ein Zufluss der Erträge vor.
Einzelfälle zum Zufluss von Kapitaleinnahmen
- Abgezinste Wertpapiere
Bei Einlösung/Veräußerung des Wertpapiers fließt der Kapitalertrag i.H.d. Unterschiedsbetrags zwischen Ausgabepreis und Einlösungsbetrag/Veräußerungspreis zu.
- Banküberweisung
Mit Gutschrift auf dem Konto des Empfängers ist regelmäßig der Zufluss anzunehmen, da der Empfänger dann über den Betrag verfügen kann.
- Bausparguthaben
Zinsen sind auch dann jährlich zugeflossen, wenn sie nicht ausgezahlt werden, sondern dem Bausparguthaben zugeschlagen werden. Werden Bonuszinsen aus einem Bausparvertrag nur buchmäßig auf einem Bonuskonto ausgewiesen, liegt noch kein Zufluss vor.
- Dividendenscheine
Dividenden fließen dem Anteilseigner bei Einlösung der Dividendenscheine zu.
- Gewinnausschüttungen
Grundsätzlich fließen Gewinnausschüttungen mit Gutschrift zu. Ausnahmen: Dem Alleingesellschafter ist die Ausschüttung bereits zum Zeitpunkt des Ausschüttungsbeschlusses zuzurechnen, wenn später eine Auszahlung/Gutschrift erfolgt.
Bei beherrschenden Gesellschaftern ist ein Zufluss bereits bei Gutschrift auf einem Verrechnungskonto der Gesellschaft bzw. bei Fälligkeit und Leistungsfähigkeit der Gesellschaft anzunehmen.
- Novation: Im Fall der Novation (= Erneuerung) wird die bisherige Schuld in ein neues Schuldverhältnis umgewandelt. Hierdurch kann ebenfalls ein Zufluss bewirkt werden.
Praxis-Beispiel (Zufluss durch Novation)
Einem stillen Gesellschafter wird der Gewinnanteil i.H.v. 5.000 € nicht ausgezahlt, sondern vereinbarungsgemäß auf seinem Vermögenseinlagekonto gutgeschrieben. Die erhöhte Einlage ist nunmehr die stille Beteiligung. Dem stillen Gesellschafter ist mit Buchung auf dem Einlagekonto durch Novation der Gewinnanteil in Höhe von 5.000 € zugeflossen.
Unterlagen zur Ermittlung der Einnahmen
Kapitaleinnahmen werden regelmäßig durch Spareinlagen, Wertpapiere oder Termingeschäfte erzielt, welche auf Konten oder in Depots bei inländischen bzw. ausländischen Banken, Kreditinstituten und Finanzunternehmen verwaltet werden. In diesen Fällen ergeben sich die Kapitaleinnahmen und die hiermit zusammenhängenden Steuern und Veräußerungskosten aus den Unterlagen der Banken.
Dies sind insbesondere
- Steuerbescheinigungen (nur bei inländischen Instituten)
- Zins-/Dividendengutschriften
- Kauf-/Verkaufsabrechnungen von Wertpapieren,
- Abrechnungen über Termingeschäfte u. Ä.,
- Erträgnisaufstellungen und
- ggf. Depotauszüge.
Im Zusammenhang mit der Umstellung der Investmentbesteuerung zum 1.1.2018 erhielten die Anleger weitere für die Besteuerung wichtige Unterlagen. Auch bei Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Instituten ergeben sich die Kapitaleinnahmen – mit Ausnahme der Steuerbescheinigungen und der besonderen Bescheinigungen zur Investmentsteuerreform – aus den o.g. Unterlagen.
Praxis-Tipp:
Steuerbescheinigung mit Eintragungshilfen: Die Steuerbescheinigungen inländischer Kreditinstitute enthalten in der Regel Hinweise auf die auszufüllenden Zeilen in der Anlage KAP.
Für Kapitaleinnahmen aus Quellen, welche nicht durch die Bank verwaltet werden (z. B. Zinsen aus privaten Darlehen, Gewinnausschüttungen einer GmbH, Einnahmen aus stillen Gesellschaften oder Steuererstattungszinsen), ergeben sich Art und Höhe der Einnahmen aus entsprechend anderen Unterlagen (z. B. Abrechnungen oder Steuerbescheinigungen). Steuerbescheinigungen sollten unbedingt aufbewahrt werden und auf Anforderung dem Finanzamt vorgelegt werden.
Quelle:EStG | Gesetzliche Regelung | § 32d Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a | 20-11-2025