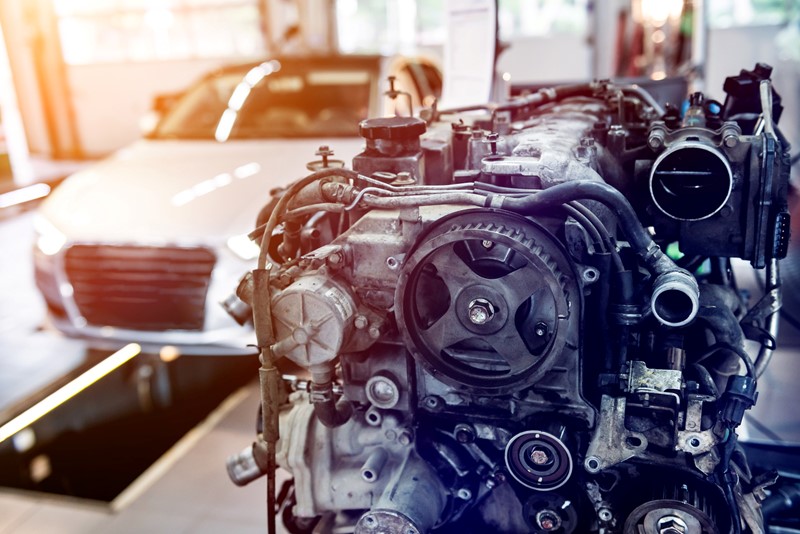Aus ertragsteuerlicher Sicht teilen Unfallkosten das Schicksal der Fahrt oder Reise, bei der sich der Unfall ereignet hat. Findet der Unfall auf einer privaten Fahrt statt, sind die Kosten, soweit sie nicht von einer Versicherung abgedeckt werden, ohne Gewinnauswirkung zu buchen. Bei einem Unfall auf einer betrieblichen Fahrt, sind die mit dem Unfall zusammenhängenden Kosten den betrieblichen Kfz-Kosten zuzurechnen. Im Gegensatz hierzu sind bei der Umsatzsteuer die Unfallkosten anteilmäßig zu erfassen.
Abgrenzung: Wann Fahrten mit dem Firmen-PKW dem privaten Bereich zugeordnet werden
Da bei einem Verkehrsunfall die Unfallkosten das Schicksal der Fahrtkosten teilen, kommt es darauf an, die jeweilige Fahrt dem betrieblichen oder privaten Bereich zuzuordnen. Das heißt, dass die Kosten privat veranlasst sind, wenn die Fahrt privat veranlasst war (Vorsicht: Eine betriebliche Fahrt wird zu einer privaten Fahrt, wenn der Unternehmer z. B. an einem Wettrennen im öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt oder alkoholbedingt fahruntüchtig ist.)
Fahrten sind und bleiben betrieblich, auch wenn eine untergeordnete private Mitveranlassung vorliegt. Das ist z. B. der Fall, wenn der Unternehmer auf einer beruflich veranlassten Fahrt einen Bekannten aus privaten Gründen mitnimmt. Wegen der untergeordneten privaten Mitveranlassung sind alle Kosten als Betriebsausgaben abziehbar. Entstehen jedoch aus dieser privaten Mitveranlassung erhebliche Kosten, können diese nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden. Das ist z. B. der Fall, wenn der Unternehmer aufgrund eines Unfalls seinem privaten Mitfahrer Schadensersatz leisten muss (BFH-Urteil vom 1.12.2005, IV R 26/04). Zahlungen an den geschädigten Mitfahrer sind keine Betriebsausgaben.
Beurteilung von Unfallkosten
Nach dem BFH-Urteil vom 18.4.2007 (XI R 60/04) gilt eine einheitliche Linie, die sowohl von den Finanzgerichten als auch von der Finanzverwaltung vertreten wird. Es kann von Folgendem ausgegangen werden:
- Ein PKW, der zum Betriebsvermögen gehört, ist und bleibt Betriebsvermögen, auch wenn der Unternehmer seinen Firmen-PKW für private Fahrten nutzt.
- Bei einer privaten Fahrt dürfen die Aufwendungen, die über die Erstattung der Versicherung hinausgehen, nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden; bei einer betrieblichen Fahrt sind die Aufwendungen gewinnmindernd abziehbar.
- Tritt bei einem Unfall auf einer betrieblichen Fahrt ein Totalschaden ein, ist der Buchwert des PKW als Betriebsausgabe zu buchen. Zahlungen für den zerstörten PKW und Erstattungen von einer Versicherung werden als Betriebseinnahmen erfasst.
- Tritt bei einem Unfall auf einer privaten Fahrt ein Totalschaden ein, liegt gemäß in Höhe des Restbuchwerts eine Nutzungsentnahme vor (R 4.7 Abs. 1 EStR). Zahlungen einer Versicherung sind als Betriebseinnahmen zu erfassen, soweit der Betrag über den Restbuchwert hinausgeht.
- Ist der Unternehmer zum Vorsteuerabzug berechtigt, kann er die Vorsteuer immer in vollem Umfang geltend machen, auch wenn sich der Unfall auf einer privaten Fahrt ereignet hat.
Unfallkosten werden ertragsteuerlich und umsatzsteuerlich teilweise unterschiedlich behandelt. Die Auswirkungen hängen insbesondere davon ab, ob die eigene Versicherung oder die Versicherung des Unfallgegners für den Schaden aufkommt. Problematisch ist es für den Unternehmer, wenn die Haftpflichtversicherung des Unfallgegners oder die eigene Vollkaskoversicherung keinen Ersatz leistet.
Auswirkungen bei einem Unfall mit Totalschaden: Es werden keine stillen Reserven realisiert, wenn der Firmen-PKW eines Unternehmers während einer privaten Fahrt zerstört wird. Das heißt, der Unfall auf einer privaten Fahrt führt nicht zu einer Gewinnrealisierung. Vielmehr liegt in Höhe des Buchwerts eine Nutzungsentnahme vor. Schadenersatzforderungen für den zerstörten PKW sind als Betriebseinnahmen zu erfassen, soweit sie über den Buchwert hinausgehen.
Eine Kaskoversicherung, die der Unternehmer abschließt, deckt sowohl die Risiken auf betrieblichen als auch auf privaten Fahrten ab. Die Zahlung einer Kaskoversicherung ist in vollem Umfang als Betriebseinnahme zu erfassen, wenn der Firmen-PKW während einer betrieblichen Nutzung gestohlen wurde. Ist der Firmen-PKW während einer privaten Nutzung gestohlen worden, liegt in Höhe des Buchwerts eine Nutzungsentnahme vor. Zahlungen der Kaskoversicherung sind als Betriebseinnahmen zu erfassen, soweit sie über den Buchwert hinausgehen.